Ein Competition Pro segelt im hohen Bogen ins Eck neben der Knight Rider Schultasche. Das Klackern der Mikroschalter punktiert eine unheimliche Stille im sonst SID-gefluteten Computerzimmer.
Es sind die letzten Sekunden eines Joysticks, der zuvor den letzten Ninja in ein trügerisches Moor versenkt hat. In schwarze Plastiksplitter zerbirst das Eingabegerät, auf den gescheiterten Computerspieler regnen längst vergangene Erinnerungen erfolgreicher Spielstunden. David Hasselshoffs perlweißes Schultaschen-Lächeln ein stilles Kommentar ohne Ausschalter: Permadeath war einst trauriger und selbstverständlicher Alltag – eine Reflexion über das (fast) vergessene Lebensgefühl „Scheitern in Computerspielen“.
Permadeath hat über Jahrzehnte viele Gestalten angenommen. Vom trockenen „Game Over” zum Reset zu lang vergangenen Spielstufen bzw. -situationen, ob nun bei Pac Man, Pokémon oder Poker: eine Entscheidung des Spielers führt zum sofortigen Abbruch einer vereinbarten Interaktion, den Verlust einer konzentrierten Erfahrung. Permadeath funktioniert im Sinne einer sprichwörtlichen Bestrafung.

Des Spielers Bruder: Permadeath
Permadeath ist eng verwoben mit dem geistigen Zustand des „Flow”: Computer- und Videospiele unterhalten durch Herausforderungen. Um Langeweile zu vermeiden, drehen Programmierer an der Schwierigkeitsschraube. Immer wieder führte man seine Ritter, Soldaten und Weltraumschiffe durch die gleichen Stufen, bis sich schließlich der wohltuende „Flow“ einstellt und man anfängt, klare Fortschritte zu machen, seine wachsenden Fähigkeiten im Rahmen eines Spiels zu genießen. Vereinfacht bedeutet „Flow“, dass sich der Spielverlauf nicht zu schwer und frustrierend, aber auch nicht zu leicht und langweilig gestaltet.
Die Programme The Last Ninja (1987), Star Wars: Dark Forces (1995) und GTA III (2001) eignen sich zur Darstellung der Spielemechanik Permadeath über die Jahrzehnte hinweg. Vergleiche zu Sekundärbeispielen ergänzen die Analyse, um Permadeath als fundamentale Gesetzmäßigkeit der Computer- und Videospiele zu etablieren.
1.000 Sprites für einen letzten Ninja
The Last Ninja von System 3 war schwer, frustrierend und doch für Millionen Spieler ein nachhaltig spannendes Erlebnis, denn eines der erfolgreichsten C64-Spiele aller Zeiten schickt Armakuni, den letzten Schattenkrieger, auf die gefährliche Mission, seine vom bösen Kunitoki verratenen Brüder in sechs bilderbuchartigen Spielstufen zu rächen, die einzeln nachgeladen werden müssen: die Wildnis Japans, japanischen Gärten, das Gebirge, ein finsteres Verließ, der Vorhof zum Sitz Kunitokis und das Schloß selbst, das „Innere Heiligtum“.

Wie für Action-Adventures üblich, sollen Gegenstände gesammelt und an passenden Stellen eingesetzt werden. Verschiedene Waffen, die man im Spielverlauf aufnimmt, erleichtern den gelegentlichen Zweikampf. Die auffallend aufwendige Präsentation reizt auf dem Commodore 64 jedes verfügbare Byte aus. Ganzseitige Inserate feuerten monatelang den Bedarf an, protzten mit allerlei Fakten wie „1.000 Sprites”: Jeder kannte, jeder musste The Last Ninja haben.
Die ersten Schritte im kleidsamen Ninja-Jumpsuit muten entsprechend sagenhaft an: ein Buddha-Schrein da, ein fallendes Blatt dort, man wähnte sich in eine andere Welt versetzt, noch das nächste Bild möchte man bewundern, aber da sinkt der edle Kampfsportmeister zwei-, dreimal in den Sumpf – oder den Bach, Schluß mit lustig. Das Ninja-Dasein aus 1.000 Sprites kannte 1.000 Tode: nochmal alles von vorne.
Ganze Spieler spielen ein Spiel ganz oder gar nicht
Mit seiner intensiven Spielerfahrung bewegte sich The Last Ninja bereits auf dem Grat zwischen Arkade-Spaß und virtueller Existenz, denn die Identifikation riss Zzap64-Redakteur Steve Jarrat beim The Last Ninja-Test im August 1987 zu einer historischen Bemerkung hin: „Das Fehlen einer Speicherfunktion könnte besonders in späteren Spielstufen frustrierend sein” (S.105, Zzap64!, August 1987). Das Zeitalter des intensiven Mit-„Erlebens” beginnt dem Punkte- und Gegenstand-„Sammeln” den Thron streitig zu machen.

Schwierigkeitsgrad als Bewertungs-Stolperstein
Spieletests von einst belegen, dass dem Schwierigkeitsgrad generell eine tragende Rolle eingeräumt wurde: „Der Schwierigkeitsgrad des Spiels liegt viel zu hoch. Es ist praktisch kaum möglich, die ersten Level zu überleben”, mahnt Boris Schneider Activisions Predator ab, das in der Happy Computer 6/88 magere 46% erhält. Paradoxerweise verleihen Julian Rignall und das Zzap64-Team beigeistert neben 90% auch gleich den Zzap64!-Sizzler in der März 1988 Ausgabe – die Präsentation mit Liebe zum Detail sei so überwältigend – obwohl Rignall-Kollege Steve Jarrat durchaus einräumt: „Ich muss zugeben, dass es für mich ein wenig schwierig wurde, über die zweite Spielstufe hinauszukommen”.

Kleiner Preis, großer Frust
Eine professionelle Präsentation kann die legendären Ikone des Permadeath nirgendwo retten: Mastertronics technisch und optisch fulminantes The Last V8 fährt in eine Sackgasse: „[Man] kann [The Last V8] als fast unmöglich bezeichnen” sagt Boris Schneider in der 64er 4/86.
Zzap64 attestiert dem Programm „vollkommene Unspielbarkeit” in der wichtigen Weihnachtsausgabe von 1985.
Die Belastbarkeit der Spieler vor dem Hintergrund einer unterhaltsamen Genugtuung in der Realwelt wurde unausgesprochen sehr wohl und zu recht wahrgenommen. Gremlin Graphics Mitbegründer Ian Stewart vermutet, die Spiele britischer Programmierer wären so schwer gewesen, damit das subjektive Spielerlebnis der legendären Zzap64!-Redakteure Rignall und Gary Penn nicht verkürzt und die Gesamtwertung gedrückt würde. (S. 143, A Gremlin in the Works).
Chris Shrigley, Programmierer einer der fordernsten Gremlin-Titel, Bounder, widerspricht schlüssig dieser These: „Jeder spielte Arkade-Spiele, die berüchtigt waren für ihr Schwierigkeitsniveau. […] Man könnte uns als ‚abgehärtete‘ Spieler sehen, […] also entwickelten wir unsere Spiele so, dass sie für uns eine Herausforderung waren” (S. 143, A Gremlin in the Works). Shrigley bestätigt eine schleichende Weiterentwicklung der Spielerfähigkeiten, steht doch heute der sanfte Einstieg durch behutsame Tutorials im Vordergrund: Tatsächlich gaben Verkaufszahlen von einst keinen Hinweis auf Ablehnung, warum sollten sie auch, könnte man an dieser Stelle fragen. Was passiert denn schon, wenn der Bildschirm ein „Game Over” zitiert?
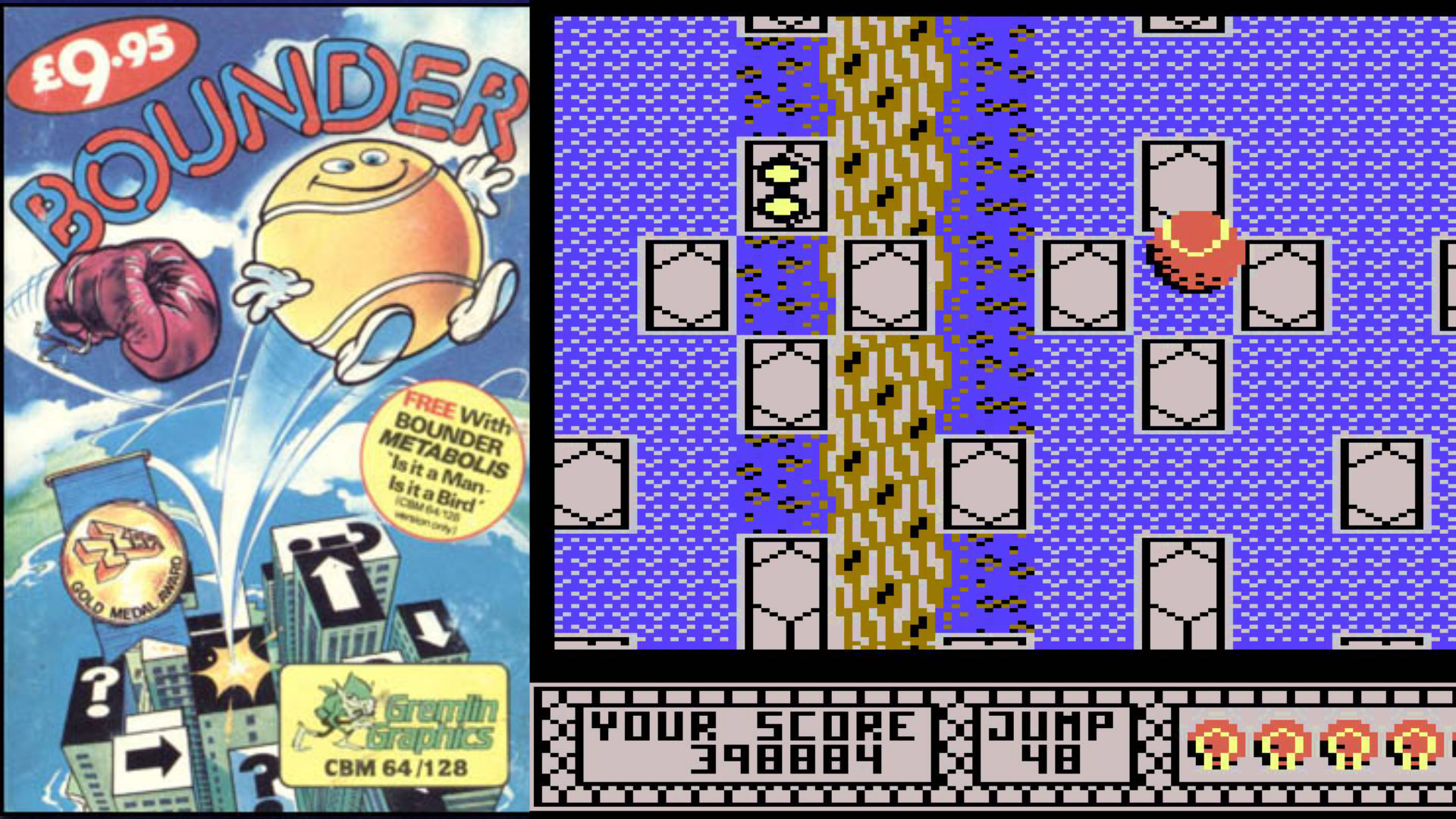
Besitz und Die Bewusstseinseinstellung „Permadeath”
Noch „ein Leben haben” und das „letzte Leben” verloren zu haben sind kontext-relevante Bewusstseinsbeschreibungen, die so natürlich und angeboren wie ursächlich übertrieben sind: Spieler versetzen sich stets in eine virtuelle Welt hinein und artikulieren sich, als wäre ihr reales Leben betroffen. Aber verglichen mit einem tatsächlichen Leben beschenkten die ersten Computer- und Videospiele den Spieler doch nur mit Extrawaffen, also eigentlich Verbrauchsgütern, allein die Punktezahl würde nach dem digitalen „Ableben” Bestand haben – solange Strom durch den Prozessor lief. Man „lebte“ also nie sprichwörtlich, sah man sich doch nur Geschicklichkeitstests gestellt, die meistens mit Übung und Geduld den Weg zum Erfolg und erfüllenden „Flow” erschlossen.
Das weiter vertiefende Gefühl des „Besitzes”, das Gefühl einer virtuellen „Gesellschaftsstellung”, war selbstverständlich nicht erreichbar. Als letzter Ninja meistert der Spieler eine Liste an schön bebilderten Herausforderungen ab, der Illusion erliegend, mit The Last Ninja das mittelalterliche Japan zu erforschen. Die „Erforschung” selbst bestand in The Last Ninja im Abgehen abgegrenzter Wege. „Forschen“ war also gleichbedeutend mit trivialem „Weiterkommen”. Man wusste es nicht besser, „Sein“, „Besitz“ und „Erforschung“ in einstigen AAA-Titeln erkennen wir heute als Ergebnis ausgeklügelten Spieldesigns und technisch bedingter Konditionierung.
Wie verändert sich nun die Einstellung gegenüber Permadeath, wenn das Spielen schließlich doch zur sprichwörtlichen Erkundung wird und der Spieler unweigerlich eine Beziehung zu einer virtuellen Welt aufbaut? Verliert man dann nicht tatsächlich das „letzte Leben”, das mühsam aufgebaute Alter Ego der nun erforschbaren, digitalen Welt?
Möge der Permadeath mit Dir sein, Star Wars-Söldner
1995 veröffentlicht LucasArts seinen Doom-Klon „Star Wars: Dark Forces”. Kyle Katarn, Söldner und sowieso rau, kantig und gut, ist auf der Suche nach einer neuen Wunderwaffe, die auf den grimmigen Namen Dark Trooper hört. In 14 Spielstufen erforschten Rebellen-Söldner weitreichende Welten aus der Ego-Perspektive und in Echtzeit.

Anders als bei The Last Ninja sah man die Welt tatsächlich durch die Augen des In-Game Helden Katarn, die Identifikation war spielimmanent: der Spieler handelte als Katarn. Aber: die Sache mit dem Eisplaneten – ohne „Cleats” rutscht man munter zum Level-Anfang. Die Sache mit Jabba: kaum vom Sternen-Mafiaboss geschnappt, wird man Kell-Drachen zum Fraß vorgeworfen – wer da nicht boxt, ist selber schuld. Aber dann die Sache mit Boba Fett. Jeder Dark Forces Spieler war ein richtig großer Fan von diesem Kopfgeldjäger: lässig eines Nachts auf Coruscant, dem Heimatplanet des imperiums joggend, die Percussion Rifle fest in Händen, bleibt der Spieler verduzt stehen, macht in der Ferne ein paar sonderbare Pixel aus. Und die anderen vier Pixel werden immer größer: Hallo Level-Anfang.

Spielezeitschriften-Legende Heinrich Lenhardt merkte erschwerend an gegenüber dem Ego-Shooter aus einer weit, weit entfernten Galaxie, in einer an sich sehr positiven (85%) Rezension (PC Player 5/1995): „Nervig: Speichern ist nicht jederzeit möglich. […] Kurzweilige Action-Hetzjagd im Star Wars-Universum, nicht mehr und nicht weniger.” Und man wurde in Dark Forces mit besonderer Ortskenntnis einer weit, weit entfernten Galaxie ausgestattet.
Save States Marke 80er
Der markige „Expansion Port” des C64 wurde nicht nur für Andrew Spencers International Soccer genutzt, sondern auch sogenannte „Freezer”-Module. Ob Action Replay, Final Cartridge oder Freeze Frame, alle boten mehr oder weniger umfangreiche Erweiterungen des C64 Basic, Diskettenmonitor, Sprite-Kollisionsunterdrückung und Sicherungsfunktionen, die durchaus so weit gingen, dass man mitten im Spielverlauf einen Defacto-Spielstand einfrieren konnte. Weil man damals besonders gerne, viel und oft „sicherte”, waren derartige Erweiterungsmodule sehr beliebt.
GTA III: Vom Ortskundler zum virtuellen Multi-Milliardär
Vertiefende Ortskenntnis wurde Programm mit Rockstar Games‘ Grand Theft Auto III (2001). Die heute milliardenschwere Spielereihe GTA wandelte sich mit dem dritten Teil von einem 2D Actionspiel zu einer immer intensiveren Weltsimulation in der heute weit verbreiteten Über-die-Schulter Perspektive. Abseits einer filmreifen Handlung im Mafia- und Gangster-Milieu steht es dem Spieler vollkommen frei, anders als bei Dark Forces, Stadt und Umgebung zu erkunden, Ausrüstung zu kaufen, Autos zu stehlen oder sich im Glückspiel zu versuchen. Missionen mit festgelegten Wegpunkten und Vorgangsweisen gaben spielerischen Freimut brüderlich die Hand; war man in einem Dark Forces eben ein Söldner, so kann man besonders in den zeitgenössischen GTA III-Fortsetzungen sogar ein Selfmade-Millionär werden. Die Designer offerieren eine in sich stringente alternative Realität, deren Hauptmechanik als die Sensation virtuellen Eigentums gedeutet werden darf. Ein wichtiges Detail.

In die reale Existenz lassen sich die Jagd nach Punkten und End-of-Game Schirmen oder gar -Animationen nur schwerlich ummünzen; dem Ninja-Pyjama entwachsen und den Dark Trooper längst dem Altmetall übergeben, war der Abstraktionsgrad trotz stetiger technologischer Weiterentwicklung überwaltigend. Aber den Spieler ein alternatives Leben ausleben zu lassen, wie es bei Rollenspielen selbstredend immer schon war, aber noch dazu in Echtzeit die einem bekannte Realität in einem Spiel nachzubilden, mit allen Höhen und Tiefen, das verbindet den Spieler mit seinem Spiel ungemein. „Besitz” in einer „anderen Realität“ lautet das Zauberwort: Der einstige Geschicklichkeitstest eines Ninjas ist weltbewegenden Überlegungen gewichen, denn in welche Firma investiere ich? Lohnt sich das Lear Jet-Upgrade? Wann nehme ich an dem Stunt-Rennen teil? – die umfangreiche, missionen-basierte Spielgeschichte wirkt dagegen fast schon wie schmuckes Beiwerk. Hier wird per Gamepad gelebt, praktische Wiederherstellungspunkte inklusive.

Zwischen dem virtuellen Beziehungs-, Mafia- und Wirtschaftsleben lässt GTA Spieler quasi „on the fly“ abspeichern, den Fortschritt durch beispielsweise lässiges Einparken in der eigenen Garage sichern, ehe man sich zur virtuellen Kraftkammer aufmacht, um sich ein wenig virtuell zu stählen, also sogar noch tiefer in sein Alter Ego eindringt und gekonnt die Eitelkeit per Spielmechanik schürt – der Spieler muss sich, wie im echten Leben, um sich kümmern, während zum Beispiel Kyle Katarn ein klassischer „off the shelf”-Held war, ab Werk einfach rau, kantig und gut. Permadeath passiert in GTA eben ob dieser Identifikationstiefe nur in Form von etappenweisen Scheitern innerhalb von Minimissionen, allerdings ist auch hier das Speichern derart organisch wie selbstverständlich in den Spielverlauf verbaut, dass ein Reset zum besitzlosen Spielbeginn doch höchst unwahrscheinlich ist. GTA realisiert gewissermaßen den Wunschtraum eines jeden Spielers der 70er/80er/90er, wird doch der Fortschritt brav mitgeschrieben und der Spieler zu Experimenten angespornt, was wiederum zu einer noch innigeren Erfahrung der virtuellen Spielewelt führt.
Das Gesetz des Westens und die Relativität des Permadeath
GTA verkauft heute jenes Konzept mit allen heute zur Verfügung stehenden Mitteln, das einst Alan Miller mit Law of the West revolutioniert hat: ohne komplexe Werte, Würfel oder Strichmännchen durchlebt der Spieler einen gewöhnlichen Arbeitstag als Sherrif einer nicht ganz so verschlafenen Westernstadt. Sehr geschickt wird durch die für 1985 überaus innovative Über-die-Colt-und-Schulter Perspektive der Spaziergang als „freie” Erkundung der Stadt vorgegaugelt: wie später auch bei GTA III und seinen Nachfolgern sieht der Spieler das Geschehen quasi aus dem Blickwinkel einer imaginären Verfolgerkamera, sodass – und das ist ein weiterer essentieller Faktor – der Spieler zusätzlich auch seine Figur, seinen Proxy, in einer virtuellen Welt zu sehen bekommt. Also vermengt sich eine hautnahe Spielerfahrung mit der Bewunderung des In-Game Helden – im Kopf ist man vollends eins mit seinem Helden, den man zeitgleich anhimmelt und selbst steuert, auch schon im Jahr 1985.

Law of the West reüssierte gerade wegen dieser optisch getriggerten Identifikationserfahrung als Genre-Chamäleon, ein für GTA wegbereitender Ansatz, den Spieler in ein anderes Leben zu versetzen – auch wenn Law of the West eigentlich ein „on rails”-Multiple-Choice Adventure mit überschaubaren Zufalls- und Handlungsmomenten war. Die spielerische Knappheit verdichtet umgekehrt Law of the West, denn eine „schnelle Runde” wollte man immer noch herunterbiegen, so „arkadig“ das Design eines Spiels mit versteckten, einst nicht realisierbaren Visionen einer virtuellen Welt, wie sie heute GTA schafft. Gewissermaßen als Vorgeschmack auf die grundsätzliche Milde eines GTA gewährte Alan Miller auch mittels der schnellen Wiederholbarkeit des Spielerlebnisses wohlwollend abgedämpftes Scheitern – wie auch öftere Wiederholungen, ähnlich fordernden Arkadetiteln, sodass sich Law of the West besonders einprägsam in den Erinnerungen des Spielers verewigte. Anders betrachtet: Permadeath war bei Law of the West verkraftbar angesichts des Spielumfangs. Und damit kehren wir zum Permadeath als natürliche Grundlage des Spieldesigns zurück.
Arkadespieler sind nur auf der Durchreise ohne vertiefende Beziehungen
„Spielfortschritt“ wird gewiss unterschiedlich bemessen. Ausgetauschte Hintergrund-Assets deuten eine Handlung sanft an, der Spieler befindet sich förmlich nur auf der Durchreise, kennt die jeweils ansässigen Figuren eines Arkadetitels nicht namentlich oder baut gar (Geschäfts-)Beziehungen auf. Ein Prospekt fantastischer Landschaften zieht stoisch vorüber, ohne eine Einladung dem Spieler auszusprechen, der sich oberflächlich um eine High Score bemüht. Unabhängig von der Art des Auslösers, ob nun begründet oder in den Augen des Spielers unfair, führt Permadeath jedermann zurück zur nackten Meßbarkeit der Leistung. Aber ab wann setzt die Notwendigkeit ein, Permadeath abzufedern, die Angst zu lindern, mit dem „letzten Leben“ „leben” zu müssen? Schon bevor The Last Ninja Steve Jarret anspornte, Speicherfunktionen in Actiom-Adventure Spielen vorzuschlagen, nutze Atari Games die situativen Vorzüge der Arkadespiele, um Permadeath zu mildern.
Wozu Hit Points? Wahre Krieger haben echte Coins
Gauntlet von Atari Games übertrug die Dungeons & Dragons Philosophie auf die münzenschluckenden Automaten der 80er. Mit einem stark vereinfachten Charakterwerte-Modell und als Rollenspielgegenstände getarnte Power-Ups vermittelt Gauntlet den Eindruck eines Rollenspielabends auf Steroiden. Donnernd kommentiert die Stimme eines allwissenden Dungeon Masters, welche Figur der Party gerade Brot, Trank oder eben Coins benötigt, da sich die Health Points angesichts einer bewusst unschaffbaren Schar an Geistern, Goblins und Tunichtguts stets dramatisch gegen 0 neigte. Ohne das nötige Schmarte geht auch ein Gauntlet-Abenteuer zu Ende: man hadert demnach nicht mehr mit „seinem letzten Leben” sondern seinem „letzten Groschen”. Trotz monetärer Dramatik vernimmt man kein Wehklagen, niemals Gauntlet beendet zu haben. Der Groschen fällt in der Tat…

Klagen über unvollkommene Spieleleistungen verstummen angesichts der unzähligen Erinnerungen, wie man mit guten Freunden und netten Menschen Monster-Sprites in Personalunion geschnetzelt hat. Permadeath tritt hier nämlich bescheiden in den Hintergrund, weil die gemeinschaftliche Erfahrung, anders als bei The Last Ninja oder Dark Forces, unterbewußt das eigentliche und schöne Spielziel darstellt. Permadeath natürlich oberflächlich als Umsatztreiber, aber auch akzeptable Nebenerscheinung gemessen am Spielerlebnis mit Freunden: ein Spielstand würde hier von dem sozialen Ereignis ablenken, das gewissermaßen mit dem Permadeath, also dem Spielende, überhaupt erst eingeläutet wird. So hat das unwiderrufliche Spielende auch was Gutes: der Spieler wird in sein Leben zurückgeführt – mit schönen Spielerinnerungen, ob nun aus Gauntlets Dungeons oder GTAs bunter Nachbarschaft. Aber trifft das nicht auch auf The Last Ninja, Predator oder Dark Forces zu?
Vom Flow zum Death: Resümée
Vom „letzten Leben” zum genüßlichen Abend unter Freunden Jahrzehnte nach den Sternstunden der Computer- und Videospielindustrie: Permadeath ist immer Anstoßpunkt und Reibebaum, verlässlicher Auslöser von Emotionen, Diskussionen und gelegentlich zerborstener Controller. Bei aller Kritik stellt sich Permadeath zu guter Letzt über die Jahrzehnte hinweg als Grundpfeiler der Spielemotivation heraus.
Es braucht eben immer ein Hindernis, ebenso wie eine rationale Gestaltung der Konsequenz, sollte der Spieler scheitern. Ein Spieler kann nämlich nicht nicht spielen. Emotional ist er sehr wohl in der Lage, desinteressiert und gelangweilt zu sein. Ohne Emotion kein Erlebnis, ohne Erlebnis keine Erzählung unter Freunden.
„Anspruchslose Spiele?”
Die PC Player Redaktion veranstaltete im Herbst 1995 eine Online-Diskussion über das „Verseichten” des Anspruchs von PC Spielen. Die Teilnehmer orten im CD-ROM getriebenen Schwerpunkt auf Präsentation einen der Hauptgründe, weil Grafik einschränke; Boris Schneider zieht hier einen Vergleich zu Film und Buch.
Schneider hält ebenso fest, dass die Entwicklung der PC Spiele hin zur Massenware folglich Tribute dem Spielanspruch abverlangt, da nun ein Querschnitt der Gesellschaft unterhalten werden muss – und nicht nur Nischen, also Intensivspieler, höchst involvierte „Experten” mit dem goldenen Arkade-Orden. Ebenso findet das damals aktuelle Dark Forces Erwähnung, dessen fehlender Quick-Save als künstliche Verlängerung der Spieldauer ausgelegt werden könnte.
Indes vermutete Boris Schneider, dass nach dem lockeren Point & Click Adventure Full Throttle, mit dem für Winter 1995 angekündigten The Dig die PC Spiele wieder zur alten Klasse zurückfinden.
Kontrolle und Mangel
Wenn Spieletester den Schwierigkeitsgrad ausloten, dann spricht man eigentlich von Kontrolle: Im überaus empfehlenswerten Essay „The Art of Failure”, führt Jesper Juul aus, dass Spieler, die ein Spiel nicht abschließen können, permanent mit einem Mangel behaftet sind – im Gegensatz zu vorübergehenden Zielen wie eine Runde Schach oder die persönliche Verbesserung z.B. durch eine höhere Punktezahl oder schnellere Speedruns (S.87, The Art of Failure). Permadeath verschärfte die Situation, weil die Bestrafung derart endgültig war, wenn man die Kontrolle verlor: So enttäuschte Chris Shrigleys Bounder Boris Schneider beim intensiven Nachtesten des harten Top-Down Scrollers für das Happy Computer Sonderheft 11 (1986): „Bounder wird ab dem fünften oder sechsten Bild absolut unspielbar. Teilweise ist es unmöglich, auch nur drei oder vier Sprünge zu machen, ohne gegen irgend etwas dagegenzuknallen”. Boris Schneider war nicht per se gescheitert, der einstige Happy-Tester wollte das Spiel nicht mehr spielen, weil sein Spielziel unerreichbar schien, nämlich die für seinen Maßstab wichtige Unterhaltung. Boris Schneider „entzog“ sich also dem Beweis seiner Fähigkeiten anhand von Bounder, um schlüssig in Relation zur Realwelt und ihrem gebührenden Anspruch auf Aufmerksamkeit zu argumentieren, wie er per Cheat-Modus die Unschaffbarkeit des Programms belegte: „Was nützen die zehn schönsten Level, wenn man noch nicht einmal den fünften erreichen kann?” Tausende Joysticks sind dem guten Boris Schneider dankbar, der mit den folgenden Worten schließt: „Wer einen wirklich harten Spielebrocken sucht, […] könnte mit Bounder zufrieden sein” – wie es Chris Shrigley implizierte und die heutige Spielergeneration mit einer Dark Souls-Reihe weiter im Austausch mit anderen Spielern zelebriert: Mit dem virtuellen Ableben steigt man wieder in die reale Welt ein. Dort wo es Joystick-Splitter regnet.
So still war David Hasselhoffs Lächeln also doch nicht: Danke Permadeath für Jahrzehnte an Erfahrungen und Freundschaften, die es sonst nicht gegeben hätte und geben wird. „Es ist doch alles nur ein Spiel” lächelt die Schultasche. Danke, Kumpel.

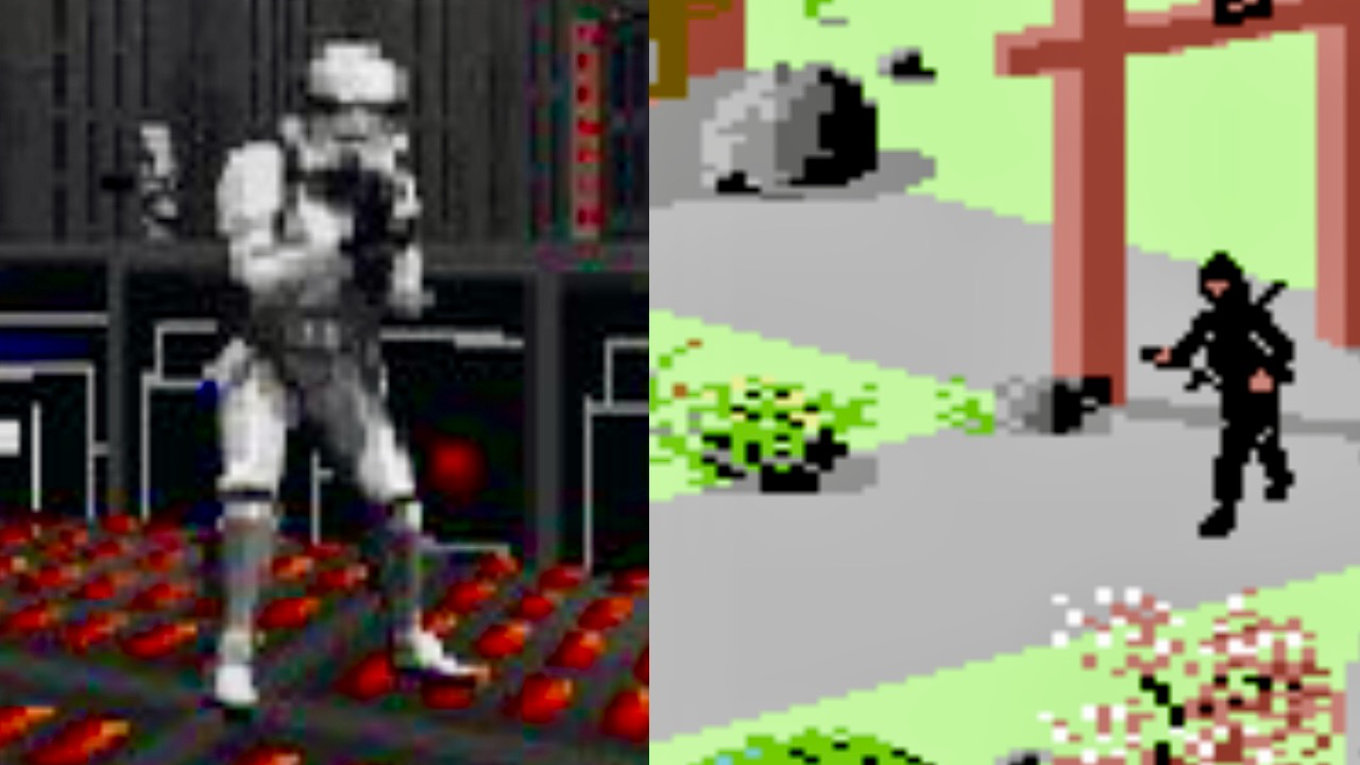



Schreibe einen Kommentar